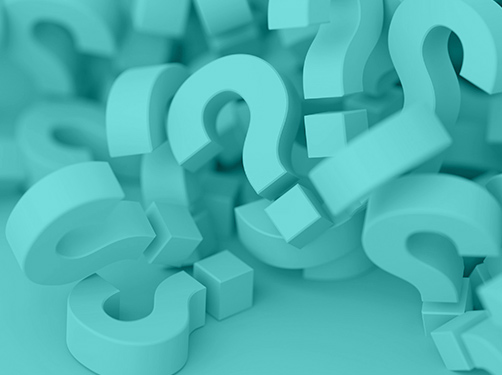Recht und Soziales: Was steht Menschen mit Diabetes zu?
Wissenschaftliche Unterstützung: RA Oliver Ebert
Eine Diabetes-Erkrankung kann viele rechtliche und soziale Auswirkungen haben. Schon in der Kindheit stellt sich die Frage, ob einem Kind die Aufnahme in den Kindergarten verweigert werden kann. Auch bezüglich der Schule, im Beruf oder bei Versicherungen gibt es viele Rechtsfragen.
Damit Menschen mit Diabetes über ihre Rechte informiert sind und die damit einhergehenden Vor- und Nachteile kennen, haben wir im Folgenden relevante Themen zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis
1. Diabetes in Kindergarten und Schule
Ein Kind mit Typ-1-Diabetes darf grundsätzlich jeden Kindergarten und jede Schule besuchen. Nur in extremen Ausnahmefällen ist der Besuch einer Sonderschule nötig. Im Mittelpunkt steht dabei, dass die Gesundheit des Kindes gesichert ist.
Welche Unterstützung kann von Kindergärten und Schulen erwartet werden?
Eltern müssen wissen, dass das Personal in Kindergärten und Schulen nur zur Hilfe im Notfall verpflichtet ist. Das Blutzuckermessen oder die Verabreichung von Insulin müssen sie nicht verantworten.
Spricht jedoch aus ärztlicher Sicht nichts dagegen, kann das Personal diese Aufgaben übernehmen. Dafür sollten die Eltern den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Lehrkräften die Aufgaben ausdrücklich und am besten schriftlich mit einer Handlungsanleitung übertragen.
Nutzen Sie hierzu beispielsweise das Dokument „Ich habe Diabetes Typ 1“. Hier können die wichtigsten Informationen über die Erkrankung des Kindes eingetragen werden. So weiß das Betreuungspersonal im Notfall, was zu tun ist.
Unterstützung durch Integrationshilfen oder Schulgesundheitsfachkräfte
Um Kindern mit Typ-1-Diabetes den Besuch in normalen Kindergärten und Schulen zu ermöglichen, kann der Arzt eine häusliche Krankenpflege in Form einer Schulbegleitung verordnen.
Eine Begleitperson oder ein ambulanter Pflegedienst übernehmen dann die Blutzuckerkontrolle und die Insulingabe während der Zeit im Kindergarten und in der Schule. Die Eltern können auch eine monatliche Geldleistung beantragen, mit der sie selbst eine Begleitperson bezahlen.
Die Eltern benötigen für den Antrag eine Begründung der Ärztin oder des Arztes, dass das Kind ohne die Begleitperson die Therapieziele nicht erreichen kann (Behandlungssicherungspflege nach §37 Abs. 2 SGB V) und in welchem zeitlichen Umfang diese benötigt wird. Sinnvoll ist auch eine Stellungnahme des Kindergartens oder der Schule, dass die medizinische Unterstützung nicht vom Betreuungspersonal gewährleistet werden kann.
Auch Schulgesundheitsfachkräfte können eine Unterstützung sein. Eltern sollten sich direkt bei der Schule oder der jeweiligen Bildungsbehörde informieren, ob solche Personen an der jeweiligen Schule angestellt sind und Kinder mit chronischen Erkrankungen betreuen.
Längere Bearbeitungszeit bei Prüfungen
Bei Schulprüfungen kann im Ausnahmefall eine längere Bearbeitungszeit beantragt werden – als sogenannter Nachteilsausgleich. Dies ist allerdings nur möglich, wenn durch das Blutzuckermessen und Insulinspritzen ein wesentlicher Zeitnachteil entsteht. Hierzu kann man sich an das Lehrpersonal wenden oder einen Antrag bei der Schulleitung einreichen. Die Schule entscheidet dann, ob und welche Ausgleiche gewährt werden.
Nachteilsausgleiche können Menschen mit Diabetes auch bei Prüfungen an Universitäten und Hochschulen beantragen. Die Prüfungsämter entscheiden, ob dem Antrag stattgegeben wird.
Die Erkrankung erwähnen
Es ist wichtig, dass die Diabetes-Erkrankung dem Schul- und Kindergarten-Personal bekannt ist. Während Unter- oder Überzuckerungen muss das Kind immer die Möglichkeit haben, sich darum zu kümmern. Auch während Prüfungen oder Ausflügen. Generell sollten Eltern den Umgang mit der Erkrankung mit dem Betreuungspersonal besprechen. So kann im Notfall richtig reagiert werden. Nutzen Sie hierzu zum Beispiel unsere Materialien zum Thema „Richtig handeln im Notfall bei Diabetes“.
Hier erfahren Sie mehr zum Thema Typ-1-Diabetes in Kindergarten und Schule.
diabinfo-Podcast Die "Schulkrankenschwester": Unterstützung in der Schule (Karen Kreutz-Dombrofski)
2. Diabetes und Notfallsituationen
Jeder Mensch ist per Gesetz dazu verpflichtet, anderen Menschen in gesundheitsbedrohlichen Situationen erste Hilfe zu leisten. Das gilt auch, wenn man auf einen Menschen trifft, der aufgrund einer Unter- oder Überzuckerung Hilfe benötigt, etwa weil sie oder er bewusstlos oder nicht ansprechbar ist.
Wenn nicht klar ist, ob eine Person eine Unter- oder Überzuckerung hat, sollte keine Behandlung per Insulin-Spritze oder Glukagon-Spritze beziehungsweise -Nasenspray erfolgen. Ansonsten kann sich die Situation verschlimmern. Bei Bewusstlosigkeit sollte in jedem Fall der Notruf verständigt werden (112).
Was im akuten Notfall bei Diabetes zu tun ist, lesen Sie hier.
3. Diabetes und Schwerbehindertenausweis
Ein Schwerbehindertenausweis für Menschen mit Diabetes bringt Vor- und Nachteile mit sich. Da neue Techniken zur Blutzuckereinstellung das Leben mit Diabetes zunehmend erleichtern, wird die Anerkennung einer Schwerbehinderung seltener. Trotzdem kann sich eine Antragstellung lohnen.
Einen Schwerbehindertenausweis erhält man beim zuständigen Versorgungsamt. Es muss ein Antrag auf „Feststellung der Behinderung“ gestellt werden.
Wie hoch der Grad der Behinderung (GdB) ist, wird auf Grundlage der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) ermittelt. Einen Schwerbehindertenausweis erhalten alle mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 (auf einer Skala von 0 bis 100).
Damit Menschen mit Diabetes einen Schwerbehindertenausweis ausgestellt bekommen, müssen sie folgende Voraussetzungen erfüllen – unabhängig davon, ob sie an Typ-1- oder Typ-2-Diabetes erkrankt sind:
- Tägliche Behandlung mit mindestens 4 Insulininjektionen
- Anpassung der Insulindosis an den jeweiligen Bedarf
- Erhebliche Beeinträchtigung durch gravierende Einschnitte in der Lebensführung
Die Blutzuckermessungen und die verabreichten Insulindosen müssen dabei dokumentiert werden.
Einen Schwerbehindertenausweis erhalten Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes angesichts dieser Voraussetzungen meist nur noch dann, wenn zusätzlich zum Therapieaufwand, also häufiges Messen und Spritzen, ihr Alltag massiv beeinträchtigt ist. Wer gut eingestellt ist, gilt allein aufgrund der Erkrankung nicht als schwerbehindert. Neben der Erkrankung selbst müssen noch weitere Gesundheitsbeeinträchtigungen vorliegen, beispielsweise diabetesbedingte Folgeerkrankungen wie Schädigungen der Augen, Nieren oder Nerven.
Gut zu wissen:
Der Gesetzestext, der die Anerkennung einer Schwerbehinderung regelt, ist zu finden in der Versorgungsmedizin-Verordnung unter Punkt 15.1.
Welche Vorteile entstehen durch einen Schwerbehindertenausweis?
Alle Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis können sogenannte Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. Der Schwerbehindertenausweis bringt also einige Vorteile, beispielsweise:
- Erhöhter Kündigungsschutz
- Bis zu 5 Tage zusätzlicher Urlaub pro Jahr
- Freistellung von Mehrarbeit
- Steuerfreibetrag zur Abdeckung der krankheitsbedingten Zusatzausgaben (auch für Eltern eines schwerbehinderten Kindes bis zu dessen 16. Lebensjahr)
- Vorzeitige Altersrente
- Kostenlose Beförderung im öffentlichen Personenverkehr
Die Liste der möglichen Nachteilsausgleiche ist noch länger. Allerdings führt der Besitz des Ausweises nicht automatisch zu allen Nachteilsausgleichen. Vielmehr hängen diese von der Höhe des Grades der Behinderung, den eine Amtsärztin oder ein Amtsarzt bei der Beantragung feststellt, ab.
Welche Nachteile entstehen durch einen Schwerbehindertenausweis?
Ein Schwerbehindertenausweis kann auch Nachteile bringen. So zögern manche Unternehmen, schwerbehinderte Personen einzustellen, obwohl Personen mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen sind.
Weitere Argumente, die gegen einen Schwerbehindertenausweis sprechen, sind beispielsweise:
- Gefühl der Ausgrenzung (besonders bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes)
- Die derzeitige Gesetzes- und Rechtslage kann sich ändern. Es ist nicht sicher, dass behinderte Menschen auch in der Zukunft immer vom Staat geschützt werden
- Vertragsablehnung oder schlechtere Konditionen bei Risikoversicherungen
Einen Schwerbehindertenstatus müssen Bewerberinnen oder Bewerber bei der Stellensuche nicht angeben.
Anders ist die Sachlage beim Abschluss von Risikoversicherungen (zum Beispiel Lebensversicherung, private Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung): Dort wird häufig abgefragt, ob eine Behinderung vorliegt. Dies muss wahrheitsgemäß beantwortet werden.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich vor einer Antragstellung beraten zu lassen, etwa bei Sozialverbänden wie dem Sozialverband Deutschland (SoVD) oder in einer Fachkanzlei.
4. Diabetes und Beruf
Menschen mit Diabetes stehen mit wenigen Ausnahmen alle Berufe offen. Bei der Bewerbung muss die Erkrankung nicht erwähnt werden. Auch eine Lüge als Antwort auf die Frage „Leiden Sie unter einer chronischen Erkrankung?“ wäre fast immer zulässig und bliebe dann ohne Konsequenzen.
Wenn bei der Tätigkeit allerdings Menschen gefährdet sein könnten, muss die Diabetes-Erkrankung dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin beziehungsweise dem Betriebsarzt oder der Betriebsärztin mitgeteilt werden. So zum Beispiel bei der Bedienung gefährlicher Maschinen, die höchste Konzentration erfordert.
Inzwischen gibt es nur noch wenige Berufe, die Menschen mit Diabetes verwehrt bleiben. So entschied etwa das Verwaltungsgericht des Saarlandes, dass ein Soldat mit Typ-1-Diabetes nicht in der Kampfmittelbeseitigung eingesetzt werden durfte. Zu gefährlich sei sein Einsatz unter klimatischen Extrembedingungen, bei denen die Kühlung des Insulins nicht gewährleistet werden kann.
Bei mehreren Berufen kann die individuelle Beurteilung durch eine Arbeitsmedizinerin oder einen Arbeitsmediziner notwendig sein. Dazu zählen Personen, die beruflich tauchen, fliegen oder eine Waffe tragen.
Auch bei einer beruflichen Selbstständigkeit steht Menschen mit Diabetes nichts im Wege. Jedoch kann der Abschluss mancher Versicherungen, die für die Selbstständigkeit wichtig sind, wie etwa eine Berufsunfähigkeits- und Rechtsschutzversicherung, schwieriger sein.
Gut zu wissen:
Unterstützende Rechtsberatung bieten Patientenorganisationen wie der Deutsche Diabetikerbund oder DiabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.
5. Diabetes und Versicherungen
Da eine chronische Erkrankung erhebliche Kosten mit sich bringen kann, stellen Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes ein Risiko für die meisten Versicherungen dar.
Viele Antragsformulare fragen den Gesundheitszustand oder eine Behinderung ab. Eine Diabetes-Erkrankung muss dabei angegeben werden. Sonst besteht das Risiko, dass der Versicherungsschutz unwirksam ist. Wird ein Vertrag abgeschlossen, sind die Beiträge meist hoch und die Konditionen eher ungünstig. Keine Rolle spielt der Diabetes im Sachbereich, also zum Beispiel bei einer Privathaftpflichtversicherung.
Eine gesetzliche Krankenversicherung ist in vielen Fällen die beste Lösung bei Diabetes: Hier gibt es eine Aufnahmepflicht. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung sind mit inbegriffen.
Bei privaten Krankenversicherungen können Menschen mit Diabetes komplett abgelehnt werden. Das gilt auch für private Unfallversicherungen, private Pflegeversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Lebensversicherungen.
Gut zu wissen:
Beim Thema Versicherungen können sich betroffene Personen an den Sozialverband VdK wenden.
Mit folgenden Leistungseinschränkungen müssen Menschen mit Diabetes rechnen:
- Prämienzuschläge
- Leistungsausschlüsse
- Begrenzte Versicherungsdauer auf ein festgelegtes Alter
- Begrenzte Leistungsdauer auf ein festgelegtes Alter
- Begrenzte Versicherungssumme
Die Vertragsbedingungen sollten genau gelesen werden. Manche Versicherungen zahlen im Schadensfall nur dann, wenn dieser nicht im Zusammenhang mit der Diabetes-Erkrankung steht. Wer beispielsweise aufgrund des Diabetes einen Schlaganfall erleidet, könnte dann keine Leistung erhalten.
Wie werden die Versicherungsbedingungen und Beiträge bei Diabetes festgelegt?
Bevor ein Vertrag mit der gewünschten Versicherung zustande kommt, erfolgt grundsätzlich eine Risikoprüfung. Zunächst werden die Rahmendaten (wie Eintrittsalter oder Vertragslaufzeit) betrachtet. Dann wird das objektive und subjektive Risiko überprüft. Letzteres wird von der Person über Ernährungsgewohnheiten und Verhaltensweisen beeinflusst. Das objektive Risiko bei Diabetes wird zum Beispiel durch die folgenden Informationen bestimmt:
- Diabetes-Typ (Typ 1 oder Typ 2)
- Zeitpunkt der Diagnose
- Aktuelle Einstellung
- Art der Behandlung
- Folgeerkrankungen des Diabetes
- Körpergewicht
Auf Basis dieser Risikoprüfung legt die Versicherung anschließend die Bedingungen und Beiträge fest.
Was ist bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit Diabetes zu beachten?
Vor allem für Menschen mit einer chronischen Erkrankung ist eine Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit wichtig. Doch Berufsunfähigkeitsversicherungen lehnen gerade sie häufig ab oder verlangen erhöhte Beiträge von ihnen.
Berufsunfähigkeitsversicherungen enthalten häufig einen Passus, der eine sogenannte „abstrakte Verweisbarkeit“ beinhaltet. Darunter versteht man, dass betroffene Personen im Falle einer Berufsunfähigkeit auf andere zumutbare Tätigkeiten verwiesen werden können. Dadurch verliert die Versicherung ihren eigentlichen Sinn. Grundsätzlich empfiehlt sich die Beratung durch eine unabhängige Versicherungsmaklerin beziehungsweise einen unabhängigen Versicherungsmakler, den Sozialverband VdK oder eine Verbraucherzentrale.
Fachanwältinnen und -anwälte empfehlen, Anfragen an Versicherungen zunächst anonym zu tätigen. Im Verbund der Versicherungen kann es zum Datenabgleich kommen. Es kann dann passieren, dass Versicherungen möglicherweise keinen Versicherungsschutz mehr anbieten, wenn eine andere Versicherung die Anfrage bereits abgelehnt hat.
6. Diabetes im Straßenverkehr
Bei Autofahrenden mit Diabetes besteht die Gefahr, dass aufgrund einer Stoffwechselentgleisung ein Unfall verursacht wird. Da jedoch wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass von Menschen mit Diabetes keine deutlich höhere Gefahr im Straßenverkehr ausgeht, dürfen betroffene Personen alle Fahrzeuge führen.
Einem Führerscheinerwerb steht also – fast – nichts im Wege. Das Autofahren ist dann möglich, wenn eine Unterzuckerung rechtzeitig bemerkt und behandelt werden kann.
Eine spezielle Einschätzung zur Fahrtauglichkeit ist nur dann notwendig, wenn die Ärztin oder der Arzt dies empfiehlt. Allerdings kann auch die Fahrerlaubnisbehörde eine verkehrsmedizinische Begutachtung verlangen. Wer einen Bus oder LKW fährt, muss strengere Auflagen erfüllen.
Gut zu wissen:
Während der Fahrt beziehungsweise bei laufendem Motor darf man keinen Blutzucker messen oder scannen. Es drohen Bußgeld sowie Punkte in Flensburg. Kommt es dabei zu einem Unfall, muss man mit hohen Strafen rechnen.
Quellen:
anwalt.de: Diabetes: Krankenkasse muss Kind in der Grundschule Schulbegleitung zahlen. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Versorgungs-Medizin-Verordnung – VersMedV – Versorgungsmedizinische Grundsätze. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Deutsche Diabetes Gesellschaft: Ausschuss Soziales. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Diabetiker Baden-Württemberg e.V.: Schulbegleitung bei Diabetes – Problem geklärt? (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Ebert, O. et al.: Diabetes und Straßenverkehr. In: Diabetologie, 2022, 18: 184-197
Kostenlose Urteile: Keine Übernahme als Berufssoldat wegen Erkrankung an Diabetes mellitus Typ 1. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Rechtsfragen zu Diabetes: SG Stuttgart zur Schwerbehinderung: die strenge Rechtsprechung verfestigt sich. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Ebert, O.: Schwerpunkt: Diabetes und Recht: Das steht Ihnen zu. In: Diabetes-Journal, 2019, 3: 14-29
Sozialverband VdK Deutschland e.V.: Der Schwerbehindertenausweis – Teil 2. (Letzter Abruf: 07.09.2023)
Stand: 07.09.2023